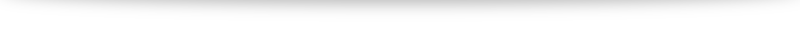Man stelle sich vor: Drei Geschwister und deren Eltern versammeln sich in Berlin, weil dort die Schwester bzw. Tochter einen Buchladen eröffnet; die Veranstaltung wird von Aktivisten gesprengt, doch als die Familie ein paar Tage später noch einmal zum Grillabend zusammenkommt, wird einer der Störenfriede eingeladen. Ist das ein Zeichen guten Willens oder mangelnder Selbstachtung?
Schönwald heißt die Familie, und in diesem mit kulturellen Codes gespickten Roman könnte man das als Chiffre für ein schöngeistiges Deutschland (das Land der Wälder), kurzum für das deutsche Bildungsbürgertum, nehmen. Die mütterliche Linie, Wartenburg, klingt auch sehr deutsch – nach Mittelalterromantik oder beinahe nach dem Ort von Martin Luthers Bibelübersetzung. Die Eltern kommen kurz nach dem Zweiten Weltkrieg auf die Welt, so wie die Bundesrepublik, und leben in Köln, der Stadt Adenauers. Sie lernen sich in den 1960er Jahren auf einem Bundeswehrball kennen, und dem Erzähler gelingt es, im Rückblick die kraftstrotzende Selbstsicherheit des damaligen juste milieu auferstehen zu lassen. In der zweiten großen Retrospektive des Romans, im von Mutter und Tochter erlebten Hamburger Universitätsmilieu der 80er Jahre, stellt sich das schon anders dar. Die Poststrukturalisten sind dabei, die Nachkriegsgermanisten mit ihrem „metaphysischen Interpretationsmethoden“ abzulösen, man ist skeptisch gegenüber allem „Absoluten und Eigentlichen“, neigt zum Psychologisieren und einem „leicht ironischen“ Ton (S. 425). Der steigert sich nach der Jahrtausendwende beim ältesten Sohn Chris, der als postmoderner Literaturwissenschaftler in New York Karriere macht, bevor er im Kontext von Metoo-Korrektheit strauchelt und ins MAGA-Lager wechselt, zum „intellektuellen Ironie-Tourette“ (S. 537).
Oehmkes Buch macht auf diese Weise die Zeitgeistströmungen von der deutschen oder westlichen Nachkriegszeit bis in die Gegenwart lebendig. Sei es durch name dropping intellektueller Ikonen („Wie alle Germanistikstudenten der späten Sechzigerjahre las sie Hermann Hesse, doch anders als die Hippies und Rebellen, die den kitschigen Steppenwolf liebten, erkannte sie in der Kontemplation des Glasperlenspiels Hesses stärkste Arbeit, denn es war, wie sie ihren Kommilitoninnen sagte, sein Gruß an Thomas Mann. Als junge Ehefrau las (und verstand) sie Erich Fromms Kunst des Liebens; als junge Mutter Alice Millers progressive Pädagogikbücher“, S. 13/14) oder durch Schlaglichter auf zeittypische Alltagsdetails: In den genussmäßig nur halbentwickelten 80ern kommen in Getränkeautomaten Kaffee und Gemüsebrühe aus derselben Düse, weshalb sich der Geschmack vermischt; in der Gegenwart der 2020er sind die kulinarisch-moralischen Ansprüche weit darüber hinaus, während das Handy wieder zum Walkie-Talkie regrediert. Das Buch liefert insofern das, was Chris als Literaturwissenschaftler beschäftigt: „Insignien […] linksliberalen Lebens“ und „popkultuelle Zeichen“ (S. 36/37).
Anhand der Figur Chris werden auch die abstrakten Wandlungen im gesellschaftlichen Klima der Ostküste thematisiert, etwa die Frage, ob die Dekonstruktion des Wahrheitsbegriffs den Boden für politische Faktenverdreher bereitete – MAGA als „postmodernes Popphänomen“ (S. 327) –, oder die Feststellung, dass anders als im 20. Jahrhundert inzwischen erwartet wird, Kritik auch dann zu akzeptieren, wenn sie nicht „berechtigt“ scheint (S. 275). Chris selbst verortet sich im „Puffer zwischen den Boomern und Millenials“, Erstere sind „ehemalige Lichtgestalten des westlich popkulturell geprägten Empires, hedonistische Alphamänner und ihre – Chris erinnerte sich an eine Formulierung von Houllebecq, die er sich eingeprägt hat – ‚legendären sexbessenen Frauen mit behaarten Muschis'“, Letztere eine Generation „mit ihrem Moralismus und Zwang zur Konfession, zum Sharen, wie sie es nannten, ihrer moralischen, identitären und mentalen Befindlichkeiten“ (S. 348).
So flüssig und stimmig die erzählten Passagen sind, so künstlich und unecht wirken die Gespräche zwischen den Figuren. Mitunter tut es weh zu lesen, wie Menschen in diesem Roman einander begegnen: Abruptes Ansprechen, hastiges Abchecken und weiter geht’s. Man könnte die schlechten Dialoge dem Autor als Schwäche anlasten. Oder man sieht eine Absicht dahinter. Denn die mangelnde Gesprächsfähigkeit problematisiert das Buch selbst in den Gedanken des Vaters Hans-Harald (wieder so ein plakativer Name): „… nie schien Zeit. Dass man einfach als Familie zusammensaß und ‚klönte‘, wie das früher hieß, dafür schien es keine Gelegenheit mehr zu geben, das war wohl abgeschafft“ (S. 276). In seiner Altherren-Leutseligkeit ist er es gewohnt, mit Hotelpersonal vertraulich ins Plaudern zu kommen – nur funktioniert das heutigentags nicht mehr. Was es dafür heute gibt und früher nicht gab, sind battle genannte Wortgefechte in „sozialen“ Medien.
Dass beziehungsstiftende Konversationen nicht mehr stattfinden, erscheint daher als ein Mangel der neuen Zeit, mit dem eine familiäre Auflösung einhergeht: Während die Eltern ihre Ehe über Krisen und Frust hinweg durchhalten, unterhält der älteste Sohn nur vorübergehende Liebschaften, die Tochter lässt sich schnell wieder scheiden, und die Ehe des Jüngsten scheint ebenfalls zu zerbrechen. Der Showdown am Ende Buches ist symbolisch zu nehmen: Alle streben auseinander, kaum dass sie zusammengekommen sind, und lassen die Eltern allein zurück. Da erscheint Rainer, der von der Tochter verstoßene Ex-Mann, der den umgekehrten Weg geht: Er, Sohn eines Schwarzen und einer Hilfsarbeiterin, will sich integrieren, nimmt den Familiennamen Schönwald an und benennt sein Lokal danach, nachdem er als Starkoch sozial aufgestiegen ist und sich als Feuilleton-Interessierter gebildet hat. So besteht die Schlussszene darin, dass er („dunkel, sehnig, rasierter Kopf, grauer Bart, Nickelbrille“) als ein Arrivierter mit Migrationshintergrund sich zu den alten Schönwalds gesellt. Er ist damit das Gegenbeispiel zu den migrantischen Aktivisten, die das erste Familientreffen verderben und von denen ein Mitglied zum zweiten kommt, um der Mutter zu entgegnen: „Ich repräsentiere das aktuelle Deutschland möglicherweise prägnanter als Sie. Sie sterben aus mit Ihrem Naziballast“ (S. 531). Die deutsche Sprache scheint hier verfremdet: „Prägnant“ repräsentieren, was soll das heißen?
Doch so eindeutig, wie bis hierhin ausgelegt, ist die Geschichte nicht. Die kommunikative Störung ist nicht nur ein Problem der Gegenwart, sondern hat ihre Vorläufer in der Eltern- und Großelterngeneration. Das wird schon in den ersten Sätzen dieses Buchs recht deutlich gesagt: Die Mutter „hatte in einem halben Jahrhundert voller sozialer Verpflichtungen die Technik perfektioniert, in Gruppen eingebunden und an Gesprächen beteiligt zu wirken, wenn sie eigentlich gar nicht da war“ (S. 9). Später erfahren wir, dass ihr Vater ihr die Haltung never explain never complain eingebleut hat. Es ist zudem nicht nur ihr Ehemann, der sich mehr Gespräche wünscht, sondern auch der spätgeborene Sohn Benjamin (natürlich muss er so heißen) beklagt, dass zu wenig aufeinander eingegangen wird, und fordert: „Familie heißt, sich Sachen sagen zu können.“ (S. 534). Etwas sentenziös heißt es weiter: „Benni tat, was in der Familie Schönwald, und erst recht in der Familie Wartenburg, noch nie jemand getan hatte: Er sprach über gefühlte Wahrheiten […] In den letzten Jahrzehnten hat die Populärpsychologie den jungen therapiebegeisterten Menschen zweierlei beigebracht: Du fühlst, was du fühlst, und deine Gefühle sind gültig und von jedermann ernst zu nehmen. Erstens. Und zweitens: Wenn du unzulänglich bist, wenn du beschädigt bist, wenn du nicht richtig funktionierst – dann besteht eine gute Chance, dass deine Eltern schuld sind.“ (S. 535). An diesen wie anderen Stellen des Buchs wird ausgesprochen, dass die Älteren, aber nicht nur diese, einen unzureichenden Zugang zum Gefühls- und Seelenleben haben.
Einen Doppelsinn erhält auch das Anliegen der afghanischen und arabischen Aktivisten. Ihre Behauptung, der Großvater wäre ins NS-Regime verstrickt gewesen, ist zwar falsch, dennoch trägt sie Früchte. Sie veranlasst die Tochter Karolin dazu, auf dem Dachboden im Elternhaus nach Zeugnissen zu suchen. Sie findet nichts, was den Großvater belasten würde, wohl aber Briefe ihrer Mutter an einen Liebhaber, mit dem diese ihren Mann über viele Jahre betrogen hat. Das wirkt wie ein Sinnbild dafür, dass Flüchtlinge die einheimische Bevölkerung dazu bringen, blinde Flecken bei sich selbst zu entdecken – während man die Einladung einer feindseligen Geflüchteten auf das Familientreffen als ein Zerrbild der „Willkommenskultur“ verstehen könnte. Dass dieselbe Person im Gespräch mit Chris „Mitleid oder Güte“ ausstrahlt (S. 175), dass die eher links zu verordnenden Aktivisten ausgerechnet einen queeren Buchladen attackieren, bricht wiederum die Klischees, wohl mit dem Zweck, den Roman vor einer Schlagseite in eine weltanschauliche Richtung zu bewahren – was schwer genug ist auf dem Kulturkampfplatz zwischen linkem Moralismus und rechtem Machtwillen, deutscher Tradition und fremder Teilhabe.
Allerdings hat das Austarieren einen künstlerischen Preis: Realistisch sind so manche Verläufe in diesem Roman nicht. Jedenfalls der Handlungskern wirkt konstruiert und überproportioniert. Die Eröffnungsfeier eines Buchgeschäfts, das Platzen einiger Farbbeutel an dessen Schaufenster und die Folgen daraus erhalten die Bedeutung eines Großereignisses, zu dem nicht nur der Bruder, sondern auch dessen Freunde aus dem Ausland anreisen, und das auf Social Media Trollarmeen aus Amerika mobilisiert. Man könnte Ähnliches vermuten wie bei den missratenen Dialogen: Es mag Absicht sein. Nämlich die Absicht, mit der Überdramatisierung politisch-mediale Übertriebenheiten der Gegenwart zu parodieren.
Im eingangs erwähnten name dropping von Geistesgrößen ragt ein Name heraus. Auf Thomas Mann wird im Laufe des Romans wiederholt verwiesen oder angespielt. Seine Homosexualität qualifiziert seine Werke für das Sortiment der queeren Buchhandlung, die Mutter beginnt eine Forschungsarbeit über ihn, Chris zieht eine Parallele von dem Exilliteraten, der mit den Deutschen moralisch abrechnete, zu den ausländischen Aktivisten (S. 321), und Chris besucht Manns ehemaliges Anwesen in Kalifornien, weil er als Schirmherr für eine dort einzurichtende Begegnungsstätte vorgesehen ist. Immer noch diese Sehnsucht nach dem Altmeister der modernen deutschen Literatur. Schon in Christian Krachts 90er-Jahre-Bestseller Faserland zog es den Helden zu Thomas Manns Ruhestätte in der Schweiz. Philipp Oehmke geht noch weiter: Die Figur Benjamin ist nicht nur der Nachzügler in der Familie, sondern bekommt auch noch Typhus – so wie Hanno Buddenbrook, wie die Literaturprofessoren in dem Buch feststellen. Tatsächlich ist Schönwald wie die Buddenbrooks ein Familienroman, in dem sich eine über viele Jahrzehnte gehende kulturgeschichtliche Entwicklung spiegelt. Im Sinne der um 1900 verbreiteten Dekadenz-Diagnose gab Mann seinem Werk den Untertitel Verfall einer Familie. In Oehmkes Buch liegt der Schwerpunkt eher auf Desintegration.